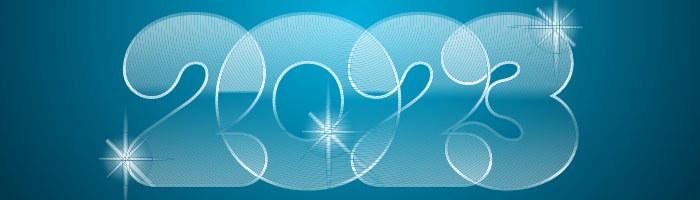So stark hat sich die Rente 2024 erhöht – doch reicht das aus?
Von Dr. Sabine Theadora Ruh, Mauritius Kloft – aktualisiert am 03.01.2025
| Das Wichtigste in Kürze |
|---|
|
Deutschlands 21 Mio. Rentnerinnen und Rentner kennen den 1. Juli eines jeden Jahres. Denn: An diesem Stichtag wird
die Rente angehoben. Dann kommt es zu einer
Rentenerhöhung oder auch Rentenanpassung. Zum Juli 2023 sind die Renten kräftig gestiegen, im Osten um
5,86 % und im Westen um 4,39 %[1]. Auch 2024 gab es eine Rentenerhöhung von 4,57 %[2].
Doch woran liegt das genau? Wir erklären, von welchen Faktoren die Rentenanpassung bestimmt wird – und was Rentner bei
der jährlichen Anhebung beachten sollten.
Vorsicht bei der Rentenanpassung!
Wann Sie in die Steuerpflicht rutschen
Wann kann ich in Rente gehen?
Alles übers Renteneintrittsalter
Wo finde ich Infos über meine
Altersvorsorge?
Zur Renteninformation
Wie wird die Rentenerhöhung berechnet?
Die Rentenerhöhung hängt grundsätzlich von der vorausgegangenen Lohnentwicklung ab. Verkürzt gesagt:
Steigen die Durchschnittslöhne in einem Jahr, steigen die Renten im darauffolgenden Jahr. Die Rentenanpassung hängt
indes von einer Vielzahl von statistischen Faktoren ab, die Niederschlag
in der folgenden Rentenanpassungsformel finden:
Rentenerhöhung in Euro = bisheriger Rentenwert × Lohnfaktor × Beitragssatzfaktor ×
Nachhaltigkeitsfaktor × ggf. Nachholfaktor
Doch der Reihe nach:
Rentenwert
Der Rentenwert[3] bestimmt – der Name lässt es
vermuten – wie viel ein Rentenpunkt wert ist. Wenn Sie
Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen, sammeln Sie Rentenpunkte. Diese bilden die Basis für die spätere
Rentenhöhe. Seit Juli 2023 liegt der Rentenwert einheitlich bei . 2024 zog der Wert erneut an – um 4,57 %. Auch bei der Berechnung der Grundrente kommt der Rentenwert ins Spiel.
Lohnfaktor
Der Lohnfaktor bildet die Lohnentwicklung des vergangenen Jahres ab – genauer: wie stark die Durchschnittslöhne
im vergangenen Jahr im Vergleich zu dem Jahr davor gestiegen oder gesunken sind.
Beitragssatzfaktor
Dieser Faktor hängt, wie der Name vermuten lässt, vom Rentenbeitrag ab. Steigt der Rentenbeitrag vom
vorvergangenen zum vergangenen Jahr an, wirkt das in der Rentenanpassungsformel entsprechend dämpfend. Bleibt der
Beitrag dagegen gleich, wird der entsprechende Faktor gleich „1“ gesetzt – und kann somit bei der Berechnung ignoriert
werden.
Nachhaltigkeitsfaktor
Der Nachhaltigkeitsfaktor setzt die aktuellen Rentnerinnen und Rentner ins Verhältnis zu den
Beitragszahlern. So soll die Rentenkasse geschont und „nachhaltig“ aufgestellt werden. Konkret funktioniert
der Faktor so: Sollte die Anzahl der Rentner schneller steigen als die Anzahl der Beitragszahler, dämpft das die
Rentenerhöhung. Zieht die Zahl der Beitragszahler hingegen zügiger an als die Zahl der Rentenbezieher, steigert das die
Rente.
Rentengarantie
Der Lohnfaktor, der Beitragssatzfaktor und der Nachhaltigkeitsfaktor werden mit dem bisherigen Rentenwert multipliziert,
um den Prozentsatz für die Rentenanpassung zu erhalten. Rentenkürzungen sind dagegen nicht möglich, sie
sind gesetzlich ausgeschlossen. Dafür sorgt die sogenannte Schutzklausel[4]. Diese Regelung ist auch als
Rentengarantie bekannt.
Nachholfaktor
Doch wegen dieser Schutzklausel kommt, wenn nötig, ein weiterer Faktor ins Spiel: der Nachholfaktor. Dieser greift dann,
wenn sich bei der Berechnung der Rentenanpassung eigentlich eine Rentenkürzung ergeben hätte, die wegen der
Rentengarantie aber ausgeschlossen ist. Der Nachholfaktor ergibt sich dann aus dem nötigen
Ausgleichsbedarf, der
entsteht. Durch den Nachholfaktor stellt der Bund sicher, dass die Rentenkasse nicht übermäßig belastet
wird. Er wurde
erst von der aktuellen Bundesregierung wieder aktiviert, nachdem er im Jahr 2016 ausgesetzt worden war.
Reicht die Rentenerhöhung aus?
Das ist die entscheidende Frage. Tatsächlich fielen die Rentenerhöhungen in den vergangenen Jahren recht üppig aus, wie
folgende Tabelle zeigt:
Jahr |
Alte Bundesländer |
Neue Bundesländer |
|---|---|---|
| 2024 | 4,57 % | 4,57 % |
| 2023 | 4,39 % | 5,86 % |
| 2022 | 5,35 % | 6,12 % |
| 2021 | – | 0,72 % |
| 2020 | 3,45 % | 4,20 % |
| 2019 | 3,18 % | 3,91 % |
| 2018 | 3,22 % | 3,37 % |
| 2017 | 1,90 % | 3,59 % |
| 2016 | 4,25 % | 5,95 % |
| 2015 | 2,10 % | 2,50 % |
| 2014 | 1,67 % | 2,53 % |
| 2013 | 0,25 % | 3,29 % |
| 2012 | 2,18 % | 2,26 % |
Wie Sie der Tabelle entnehmen können, gab es im Jahr 2021 eine Nullrunde. Ursache hierfür waren die stark
gefallenen Durchschnittslöhne im Jahr 2020 durch die Corona-Krise. Damals hätten die Renten eigentlich gekürzt
werden müssen, das verhindert aber die Rentengarantie. Also ist ein Ausgleichsbedarf entstanden, der mit dem
Nachholfaktor 2022 abgebaut worden ist. Weil sich die Löhne von 2020 zu 2021 stark erhöhten, zogen auch die Renten
entsprechend deutlich an.
Ob die jährliche Rentenerhöhung indes ausreicht, um den Lebensstandard angesichts der Inflation zu
halten, ist eine persönliche Frage, auf die es keine pauschale Antwort gibt. Klar ist aber: Verlassen sollten Sie sich
nicht darauf. Denn die absolute Höhe der Rentenanpassung ist von der Höhe Ihrer Rente, also des Grundbetrags, abhängig.
Und sollte diese schmal ausfallen, bringt Ihnen auch eine satte Rentenerhöhung wenig.
Sie sollten sich bereits frühzeitig mit Ihrer Altersvorsorge beschäftigen. Wahrscheinlich ist es auch
sinnvoll, privat vorzusorgen.
Das geht etwa, indem Sie Ihr Geld breit gestreut am Aktienmarkt anlegen – über sogenannte ETF. Auch digitale Immobilien-Investments, wie
sie auf BERGFÜRST angeboten werden, können Ihre Altersvorsorge ggf. ergänzen. Wichtig ist aber
stets, dass Sie auf die richtige Diversifikation achten.
Welche Renten unterliegen der Rentenerhöhung?
Neben der klassischen Altersrente profitieren noch mehr Rentnerinnen und Rentner in Deutschland von der Rentenerhöhung.
So unterliegen Erwerbsminderungsrenten der Rentenanpassung – das gilt auch für die Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung.
Die jährliche Rentenerhöhung greift auch für Hinterbliebenenrenten. Also werden auch Witwenrenten,
Witwerrenten und Waisenrenten jedes Jahr angepasst. Ebenso wie bei Altersrenten gilt auch bei den anderen Rentenarten
das Datum 1. Juli.
Wann wird die Rentenerhöhung ausgezahlt?
Das kommt in der Regel auf den Zeitpunkt des Renteneintritts an. So überweist die
Rentenversicherung die erhöhte Rente
bereits Ende Juni an die Rentner, die bis März 2004 in den Ruhestand eingetreten sind. Bei einem
späteren Renteneintritt
gibt es die höhere Zahlung erst einen Monat später, also Ende Juli.
Wie hoch eine Rentenerhöhung ausfällt, steht in der jährlichen Rentenanpassungsmitteilung. Diese wird je nach
Renteneintritt bis Ende Juni oder bis Ende Juli verschickt.
Kann ich bei der Rentenerhöhung in die Steuerpflicht rutschen?
Ja, das ist möglich. Denn: Die jährliche Rentenerhöhung ist voll steuerpflichtig. Dadurch kommen bei
einer Rentenerhöhung jedes Jahr immer mehr Ruheständler in die Steuerpflicht.
Um dies zu verstehen, sollte man wissen, dass in Deutschland Renten seit 2005 nachgelagert besteuert
werden[5]. Dadurch
sind die Aufwendungen für die Altersvorsorge zunehmend steuerfrei, während die Rentenbezüge im Alter schrittweise
besteuert werden.
Wie groß der steuerpflichtige Anteil der Rente ist, hängt vom Jahr des Renteneintritts ab – und bleibt dann ein Leben
lang gleich. So lag der steuerpflichtige Anteil der Rente vor 2006 bei 50 %, seitdem steigt er von Jahr zu Jahr an.
Bei
einem Renteneintritt im Jahr 2040 soll er bei 100 % liegen. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH)[6] muss der
Bund jedoch die Rentenbesteuerung anpassen und den steuerpflichtigen Anteil der Rente langsamer steigen lassen. Konkret steigt der Anteil seit 2023 nur noch um einen halben Prozentpunkt.
Im Gegenzug zur Rentenbesteuerung im Alter können die Einzahlungen für die Altersvorsorge von der Steuer abgesetzt
werden. Seit 2023 sind sie voll von der Steuer absetzbar, auch in Folge des BFH-Urteils.
Goldsparpläne im Test:
Die 10 besten Anbieter

-
Durchschnittlich 8,3 % p.a. Rendite über 20 Jahre
-
Sparpläne können günstiger sein als Direktkauf
-
Aber: Nicht jeder Sparplan lohnt sich
Wann Sie als Rentner eine Steuererklärung abgeben müssen
Rentenerhöhungen können den steuerpflichtigen Anteil der Rente erhöhen. Liegen Sie oberhalb des steuerlichen
Grundfreibetrags, müssen Sie eine Steuererklärung abgeben – und womöglich auch Steuern auf ihre Rente zahlen.
Der Grundfreibetrag steigt jedoch jedes Jahr an. Seit 2025 liegt der Grundfreibetrag bei 12.096 € (24.192 € für Paare)[7].
Kaufen Sie Gold
direkt vom Hersteller

-
Monatlich ab 10 € Gold kaufen
-
Jederzeit zum aktuellen Kurs verkaufen
-
Keine Lagergebühren
Bild-Copyright: © PantherMedia / AndrewLozovyi
Quellenangaben
- Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2023
- Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2024
- Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) – Gesetzliche Rentenversicherung: § 68 Aktueller Rentenwert
- Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) – Gesetzliche Rentenversicherung: § 68a Schutzklausel
- Deutsche Rentenversicherung: Nachgelagerte Besteuerung
- Bundesfinanzhof: Urteil vom 19. Mai 2021, X R 33/19
- Bundesministerium der Finanzen: Die wichtigsten steuerlichen Änderungen 2025